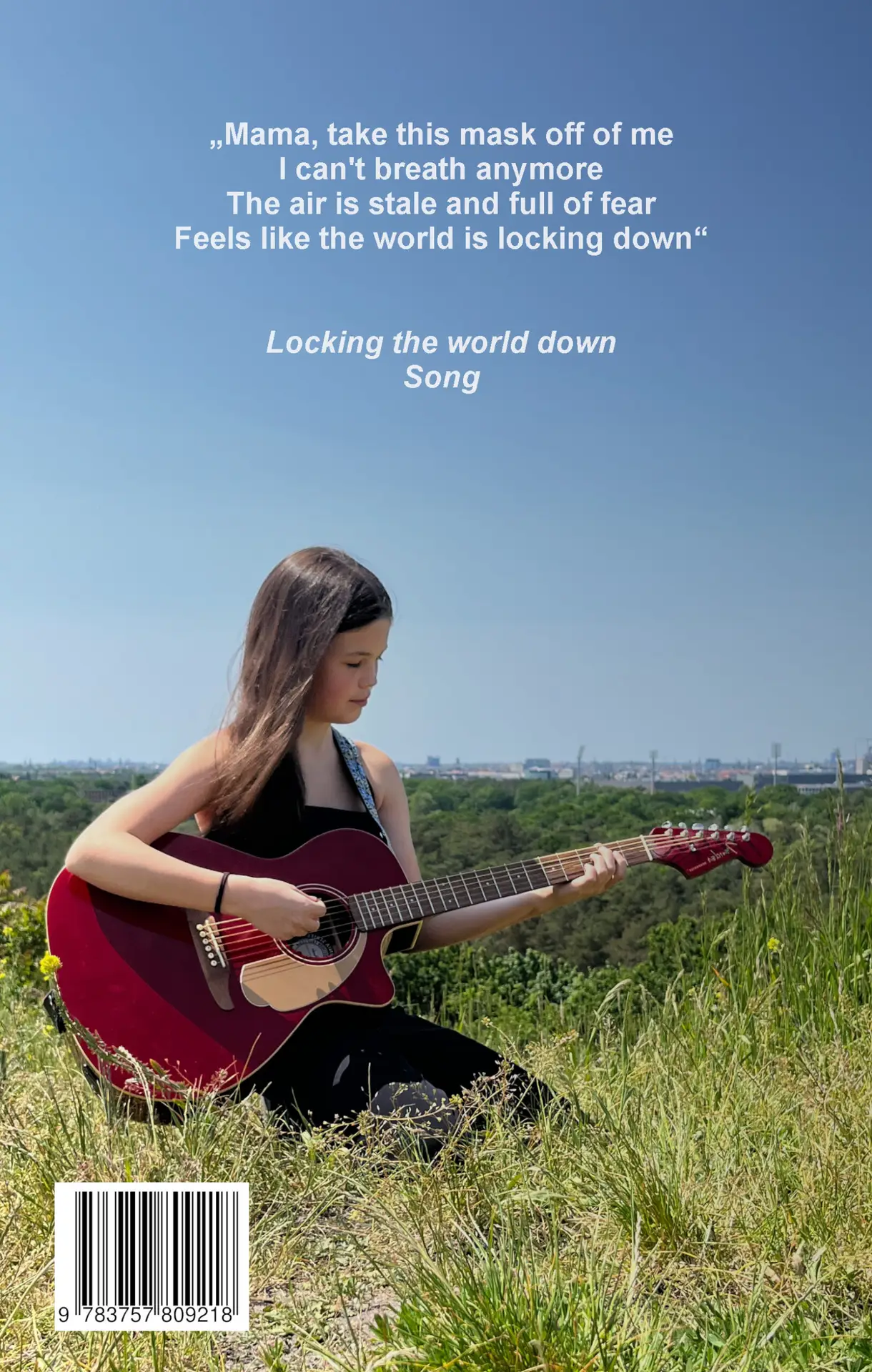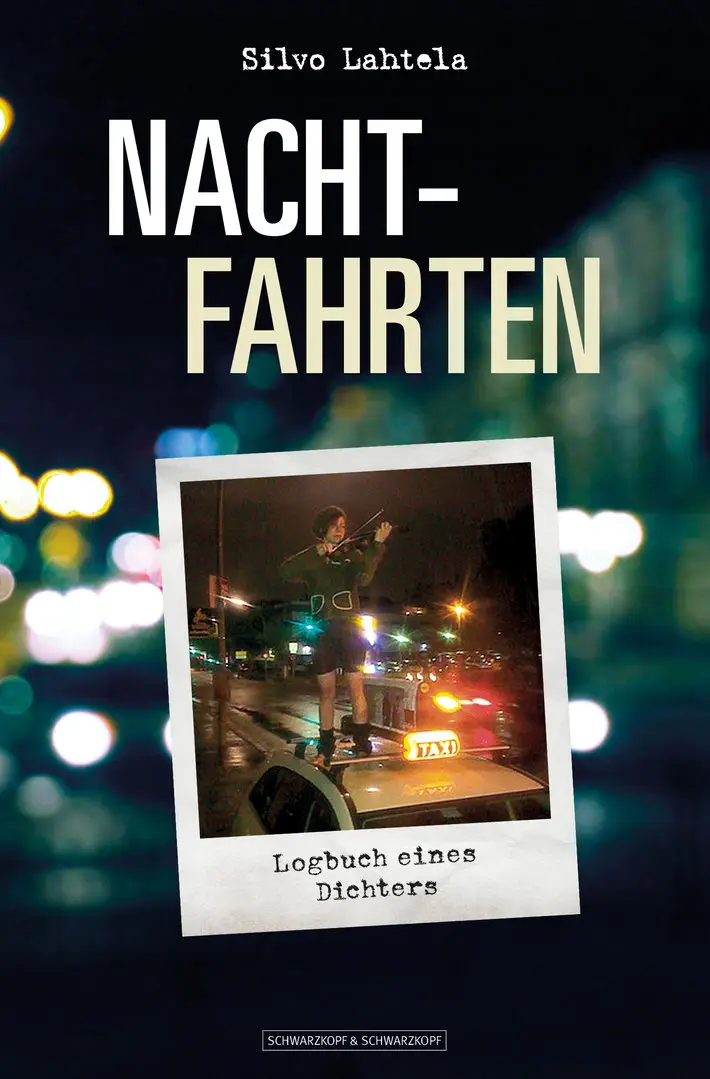Neulich war ich auf einer Vernissage im tiefsten Neukölln, dort, wo hysterische Rallyefahrer auf der Sonnenallee mit Dönerbuden, Spätis und Polizeisirenen eine rauhe multikulturelle Einheit bilden. In gewisser Weise für mich deutlich authentischer als das, was in der Ausstellung an Bildern präsentiert wurde. Was aber damit zu tun hat, daß ich vielleicht von Kunst zu viel erwarte und schnell enttäuscht bin, wenn nicht mindestens ein Van Gogh an der Wand hängt.
Es gibt eine Anekdote von Dalí, wo er nach dem Besuch einer Malerei-Ausstellung von Zeitgenossen – gefragt, wie er die Bilder dort fand – über die handwerkliche Qualität der verlegten Wasserrohre in der Toilette schwärmte. Oder so ähnlich. Diese Trotzreaktion angesichts von Werken, die eigentlich nicht besonders inspiriert sind, aber so tun, als seien sie es, kann ich innerlich gut nachvollziehen. Weswegen ich ein seltener Gast auf Ausstellungen bin und wenn doch, dann oft auf eher periphere Sachen achte.
Von einer großformatigen Zeichnung abgesehen, die für mich Aura und Gefühl hatte und die das Beitragsbild zu diesem Blog stellt, konnte ich künstlerisch nirgends andocken und verlor schnell mein Interesse an den Exponaten. Dafür fiel mir auf der Vernissage eine Frau auf, die zu aufgebrezelt war, um zu den Künstlern und Künstlerinnen zu gehören; die ja schließlich die Aufmerksamkeit auf ihre Werke an den Wänden und nicht nur wie auf einer Party auf sich als Personen lenken wollten. Damit man sie auch wirklich identifizierte, trugen sie allerdings tatsächlich ein Schildchen an der Brust mit der Aufschrift: „Artist“. Womit für mich klar war, daß sie alle eher identitätsmäßig etwas verunsichert waren, sonst würden sie eine derart bürokratische Kennzeichnung an ihrer Kleidung nicht akzeptieren. Ein echter Wolf in freier Wildbahn läßt sich kein Schleifchen umbinden, auf dem „Wolf“ steht. Pudel auf der Hundeshow natürlich schon.
Jedenfalls die Frau: Sie trug ein knielanges schwarzes Abendkleid, Tattoos mit Blumenmustern auf den freien Schultern, sorgsam weißlackierte Fingernägel, goldblond gefärbtes Haar, die Bewegungen grazil, mit konstantem leichten Hüftschwung. Eine sexy Erscheinung, deren Charme für mich allerdings darunter litt, daß ihre Lippen dezent aufgespritzt waren. Was bedeutete, daß sie ihre gesuchte soziale Anerkennung aus ihrem äußeren Erscheinungsbild bezog. Echte Elfen, die es zwar nicht gibt, aber trotzdem: die spritzen sich die Lippen nicht auf, denn das zerstört den Mythos der natürlichen Schönheit zu sehr.
In diesem Sinn besteht übrigens ein großer Unterschied zwischen aufgetragenem Lippenstift und chirurgisch vergrößerten Lippen. Das Erstere ist Maskerade, Spiel und kann jederzeit abgewischt werden. Das Letztere ist Teil der gefühlten Identität und daher, weil künstlich mit dem Körper amalgamiert, Ausdruck dessen, von Äußerlichkeiten extrem abhängig zu sein. Außerdem und das ist ästhetisch durchaus dramatisch, stimmen bei chirurgisch vergrößerten Lippen die Proportionen zum Rest des Gesichts nicht mehr. Man kann das Gewachsene eben nicht durch das Gemachte ersetzen. Was übrigens auch für Kunst gilt: Man sieht sofort, ob jemand seit zwanzig oder seit zwei Jahre malt, ob jemand wirklich von innen getrieben oder hauptsächlich vom Wunsch nach äußerem Status bestimmt ist.
Die „Marquardt Mask“, Schönheit jenseits des Make-ups
Die Schönheit eines Gesichts – für die Generation Selfie & Tattoo ist das allerdings erkenntnismäßig schwer verdaulich – liegt übrigens nicht wie oft naiverweise angenommen nur im Auge des Betrachters oder im gekonnten Make-up. Das subjektive Bauchgefühl ist zwar der Gott und Fetisch des gegenwärtigen Zeitgeistes, aber die Realität sieht etwas anders aus: Es gibt die sogenannte „Marquardt Mask“, die die subjektive Wahrnehmung von der Schönheit eines Gesichts ziemlich relativiert und durch objektive Kriterien ersetzt.
Dieser Marquardt, ein amerikanischer Chirurg, hatte sich in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gefragt, besonders bei durch Unfälle schwer verstümmelten Menschen, nach welchen Kriterien man eigentlich ein verwüstetes Gesicht plastisch wieder herstellen sollte. Denn es mußte in Hollywood, wo er hauptsächlich arbeitete, damals so gewesen sein, daß man an jeder operativ neu gemachten Nase erkennen konnte, an der Form, wiedererkennbar wie der Pinselstrich beispielsweise von Van Gogh, wer der verantwortliche Schönheitschirurg gewesen war.
Er war also auf der Suche nach objektiven Kriterien. Und fand sie. Und das Ergebnis war eben eine Gesichtsmaske, eine ästhetische Schablone, die die für Schönheit relevanten Proportionen zeigt. Weltweit als schön empfundene Gesichter, egal ob von Afrikanern, Asiaten, Europäern, Latinos oder auch Eskimos, weisen ein objektives Kriterium auf: nämlich eine dominante Häufigkeit von „goldenen Schnitten“, also die harmonischen Proportionen der einzelnen Details zueinander. Der Abstand von den Augen zu den Nasenlöchern ist beispielsweise proportional zum Abstand von den Nasenlöchern zu der Mittellinie der Lippen, oder der Abstand von der Seite des Gesichtes zum Äußeren des Auges entspricht dem Abstand vom Augenrand zum Zentrum der Pupille.
Mathematisch ist dieses Verhältnis der Teile zueinander durch die irrationalste aller Zahlen: „Phi“ ausgedrückt, (Φ = 1,61803399 ….), die sich überall in der Natur als bevorzugtes Ordnungsprinzip wiederfindet; zum Beispiel in den Windungen eines Schneckengehäuses, der Mischung von weiblichen und männlichen Bienen im Bienenstock, der Anordnung von den Blüten einer Rose und so weiter – aber eben auch in den Proportionen eines menschlichen Gesichts. Je mehr Phi, desto schöner.
Angesichts dessen, daß Schönheit in diesem objektiven Sinne einem eher selten über den Weg läuft, gibt es eine gute Nachricht: Es besteht keine Korrelation von Phi zum Charakter einer Person. Das wußten die Menschen eigentlich schon immer, intuitiv zumindest. Die ernüchternde Nachricht ist, daß eine Korrelation zur Ernährung besteht: Die Vielzahl schmaler Gesichter heutzutage, Phi ade, beruht auf wenig ausgebildeten Kiefernbögen und Wangenknochen, was wiederum auf tatsächlichen Mangel an knochenbildender Nahrung in der Kindheit und bei den nächsten Vorfahren hinweist. Aber das würde jetzt den Blog sprengen. Mehr dazu in diesem lesenswerten Buch: Deep Nutrition. Es ist nur ein Hinweis, daß die Wurzeln von Schönheit sehr viel tiefer reichen als die Oberfläche vermuten läßt. Was auf Kunst ja auch zutrifft.
Der simple Grund jedenfalls, um wieder zur Vernissage zurückzukommen, warum aufgespritzte Lippen schon theoretisch nicht für wahre Schönheit sorgen können, ist, daß diese Detailveränderung eine proportionale, aber biologisch unmögliche Adaption der Kopfgröße erfordern würde. Aber es paßt natürlich als körpermodische Parallele zu einer Gegenwart, in der sich das isolierte Ego gleichsam wie Botoxlippen ohne Grenze und Maß überall breitmacht.
Jene trotz gemachter Lippen grazil sich bewegende Frau stromerte genauso wie ich einfach nur in den Räumen herum; unser relatives Desinteresse an den Bildern an der Wand erzeugte in den Augenblicken, an denen wir aneinander vorbeigingen und uns dabei ausweichend zur Seite drehten, weil es so eng war, eine gewisse spontane Gemeinsamkeit. So war es vermutlich auch kein Zufall, daß plötzlich eine Freundin von ihr an mich herantrat und mich fragte, ob ich nicht ein Selfie von den beiden machen könnte und mir ihr Smartphone in die Hand drückte.
Machte ich natürlich, die beiden Ladys posierten also fröhlich zusammen. Etwas später sah ich jemand anders sie noch einmal fotografieren, vielleicht waren meine Fotos von zu viel kritischer Energie gespeist. Wer weiß?! Aber jedenfalls dämmerte mir, als ich wieder zurück nach Hause unterwegs war – diesmal über die Autobahn, den Berliner Stadtring, von den Neuköllner Straßen mit zu dicht, also auch psychisch distanzlos auffahrenden Egomanen hatte ich die Nase voll, von normaler Kunstkost auch –, daß diese kleine Selfie-Aktion das wahre verborgene Meisterwerk gewesen war, als unbewußte Performance und nicht als Gemälde, weil es den narzißtischen Geist der Gegenwart wirklich zum Ausdruck brachte.
Denn was die Leute heutzutage wirklich bewegt, ist genau die möglichst massenhafte Spiegelung durch andere in den sozialen Medien, die Gier nach Likes und positive Reaktionen auf beispielsweise Fotos von sich an besonderen Orten oder persönliche Meinungsäußerungen zu speziellen Themen. Fast immer geht es darum, sich selbst möglichst attraktiv und cool vor dem Hintergrund entweder von Lokalitäten oder sich mit Statements als Ausdruck irgendeiner angesagten Haltung zu präsentieren.
Die seit Jahren wie Pilze aus dem Boden schießenden Tattoos verkörpern diesen Trend, sich selbst zum Bild zu machen, im Wortsinne, viele tragen inzwischen tatsächlich ganz real ihre Haut als eine Art Logo oder Markenzeichen zu Markte. Die subjektive Perspektive hat mehr oder weniger völlig die objektive ersetzt. Die nämlich wäre, als Person etwas zurückzutreten und die Sache, welche auch immer – sei es sogar die eigene Person wie beispielsweise Van Gogh es in seinen Selbstporträts tat –, für sich selbst sprechen zu lassen. Darauf komme ich gleich noch. Das klassische, schon von Friedrich dem Großen propagierte und heute verpönte „Mehr Sein als Scheinen“ also.
Diese epidemische Selfie-Mentalität ist übrigens nicht nur auf kulturellen oder sportlichen Events zu finden. Kein Attentäter heutzutage, der was auf sich hält, versäumt es, falls er überleben sollte, sich vor dem Hintergrund seiner Taten, je grausamer, desto besser, fürs Internet visuell in Szene zu setzen. Schwarzweiße Adidas Trainingshose und Maschinengewehr waren, glaube ich, bei dem Massaker am 7. Oktober letzten Jahres in Israel eines der angesagten Outfits in der Killerszene. Nichts wäre gefühlt vermutlich schlimmer fürs fremdbestimmte Selbstbewußtsein, das von der medialen Aufmerksamkeit lebt, als wenn die Headcam beim geplanten Gemetzel wegen Batterieschwäche ausfallen sollte. Dann hätte man es ja fast gleich sein lassen können.
– Jene unbekannte Frau, die sich im langen Schwarzen sexy durch die Besucher der Ausstellung schlängelte und dann fröhlich Fotos von sich und ihrer Freundin machen ließ, repräsentierte die unbewußte, wenn auch ziemlich pervertierte Avantgarde des Zeitgeistes. Sie sparte sich den überflüssigen und auch mühseligen Umweg mit den Bildern an der Wand und kam gleich zur Sache: die da war, das eigene Ego als besonders aufscheinen zu lassen.
Dazu reichte es, sich selbst zum Bild zu machen, mit Tattoos, Schönheitsoperationen und ausgewählter Kleidung und schon dominierte man die Kunst an der Wand, die auch selten mehr als nur egomanischer Ausdruck war, problemlos. Denn ein lebendes Wesen, spätestens von der Maus an aufwärts, hat immer noch einen spontanen Aufmerksamkeits-Bonus gegenüber leblosen Dingen, vor allem, wenn diese keine wirklichen Empfindungen auslösen. Was die ausgestellten Kunstwerke zumindest bei mir – bis auf eines immerhin – nicht taten. Ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn jene Frau als recht schillernde, wenn auch künstliche Erscheinung bei den meisten Leuten mehr Eindruck hinterlassen hätte als alle Bilder an der Wand zusammengenommen.
Und das ist jetzt der Unterschied zu Werken, die wirklich berühren wie beispielsweise die Selbstporträts von Van Gogh. Während Selfies in der Regel eine Kulisse brauchen, einen Hintergrund, von dem sie ihre Bedeutung beziehen – ähnlich wie Viren einen Wirt brauchen, um zu überleben –, sind authentische Bilder mit innerer Energie aufgeladen und leben eigenständig aus sich selbst. Was der Grund ist, warum zum Beispiel Van Goghs Selbstporträts, etwa das mit Strohhut, immer noch faszinieren. Allerdings ist diese psychische Energie nicht zu faken, sondern nur zu erzeugen, wenn man das dazu entsprechende Leben lebt. Was natürlich nicht bedeuten muß, sich ein Ohr abzuschneiden. Aber es bedeutet auch nicht, risikolos im Mainstream zu schwimmen.
Was mich auf den Gedanken bringt, daß es ein Test für Kunst sein könnte, wenn man irgendwelche berühmten Persönlichkeiten zu Vernissagen einlädt, also auf dem Bekanntheitslevel von Taylor Swift oder George Clooney und dann schaut, ob sich noch jemand für die Bilder interessiert. Wenn sich stattdessen alle um die Berühmtheiten scharen, könnte man die Bilder gleich wieder abhängen und die meisten könnten aufhören zu malen. Für reale Berufsberatung aber vermutlich ein zu teures Konzept.
Ich selbst bin eher genügsam oder zu übersättigt: Für mich reichte schon die hysterische Sonnenallee und eine namenlose Frau, die sich gut bewegte, um die präsentierte Kunst ziemlich in den Schatten zu stellen. Aber weil ich durch den Besuch der Vernissage den dauerpräsenten Narzißmus der Gegenwart neu und intensiv erlebte, war es andererseits tatsächlich auch ein recht cooler Abend. Insofern verlinke ich hier die Location, vielleicht haben ja auch andere ähnlich spannende Erlebnisse dort. Lotusblumen wachsen am besten im Schlamm. Was sich wieder einmal bewahrheitet hat.